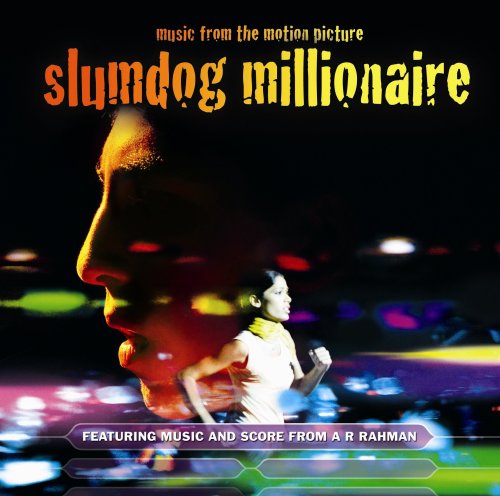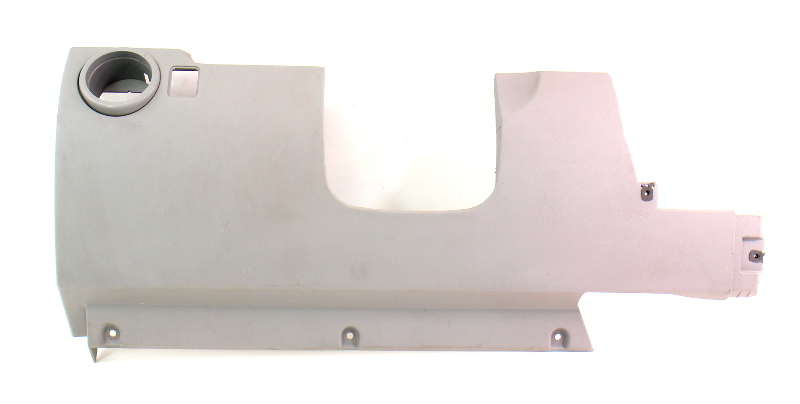Ich hatte gestern Geburtstag und entgegen meiner Überzeugungen der letzten Jahre, irgendwas für und mit irgendwem machen zu müssen, verbrachte ich den Tag größtenteils entspannt und allein zu Hause, auch um mal zu sehen, was so passieren würde. Ob ich etwas vermissen würde, ob ich traurig werden würde, ob ich mich verdammt einsam fühlen würde… Besonders letzteres war mir vergönnt. Das Telefon klingelte ununterbrochen. Es klingelte sogar an der Tür und ich musste mir irgendwann eingestehen, dass der Plan sich zu verstecken künftig ausgefeilter sein müsste.
Treue Anhänger meiner Blogtätigkeit dürften in etwa wissen, dass dieses Ruhige, Geordnete, Abwartende, Klare bislang nicht unbedingt zu meinen Stärken gezählt hatte. So sagte Marko gestern, dass ich großartig aussehen würde und klar und es gar kein Vergleich wäre zu meinem Sein der letzten zwei Jahre. Die ist vollkommen am Ende, hieß es oft, gestand er mir. Und vielleicht ist mir auch erst in diesem Moment richtig klar geworden, dass ich die ganze Zeit nicht alleine gewesen war, als ich mich im Weltschmerz auf dem Boden krümmte. Dass da Menschen gewesen waren, wenn auch wechselnde, die die Grenzen des grundsätzlich erträglichen im Blick gehabt hatten, während ich an diese stieß.
Rückblickend finde ich nicht, dass es so schlimm gewesen ist. Aber ist das nicht oft so, dass man sich die Großartigkeit des Moments ungern durch Gedanken an die harte Arbeit zuvor relativieren möchte. Man das unheimlich vielstellige Preisschild schnell vom neuen paar Schuhe abreißt im Wissen, dass man da jetzt treue Begleiter für die nächsten Jahre erstanden hat. Die Dinge haben ihren Preis und so kostet die Freiheit den Gang durch die Unterwelt.
Marko versprach mir, dass es leichter werden würde. Dass die wunderbare Eigenschaft des Alterns, neben all dem weniger erfreulichen, die Gelassenheit sei. Alles wird mit der Zeit relativ. Möglicherweise wird es auf eine gewisse Art auch “langweiliger”, weniger dramatisch und spannend. Aber – im Ernst – Ruhe und Entspannung habe ich schätzen gelernt, die letzten Jahre. Ich kenne kaum einen größeren Wert! Einfach im Garten auf der Wiese sitzen, in der Sonne dösen, mit dem Hund durch den einsamen Wald spazieren, dem Stress die Tür vor der Nase zuknallen.
Die aktuelle Ausgabe des I LOVE YOU MAGAZINES trägt den Titel “The next big thing will be ME”. Und was gibt es wichtigeres als das Selbst? Ich habe einen Text geschrieben, der nicht gedruckt wurde und den ich hier in gekürzter Form veröffentlichen möchte:
I LOVE MYSELF
Bevor ich begann Sylvia Plaths Glasglocke zu lesen, hatte das Buch eine Weile in meinem Regal gestanden. Sylvia Plath war für mich immer so eine Art Hermann Hesse gewesen. Eine Autorin, die Bücher schrieb, die einen im Innersten trafen, Bücher auch, die ihre Zeit haben. So wie Hesses Demian mich so um die 15 schwer mitgenommen hatte, so erwartete ich, dass mich Plaths Glasglocke irgendwann später treffen würde. Allein der Text auf dem Buchrücken hatte mich immer etwas abgeschreckt. Auf der Suhrkamp-Ausgabe von 1998 steht geschrieben: „Ein Buch über amerikanische Bewusstseinszustände“. So als handele es sich um ein Buch über Gegebenheiten, die mit meiner europäischen Sozialisierung nichts zu tun hätten. Als ich die Glasglocke ausgelesen hatte, blieb ich zurück mit einem dumpfen Gefühl, ähnlich wie ich es erwartet hatte. Ich war nahezu 32 Jahre alt und befand mich in eben jenem von Suhrkamp beschrieben „amerikanischen Bewusstseinszustand“. Nur dass ich 12 Jahre älter war als die Ich-Erzählerin Esther Greenwood, gut ein halbes Jahrhundert später lebte und nicht an der amerikanischen Ostküste, sondern in Berlin.
Sylvia Plath lässt in ihrem berühmtesten Roman ihre Erzählerin unter ihrer Glasglocke hervorkriechen. Bis dato hatte Esther unter dieser gelebt: Abgeschirrmt von der Außenwelt, unendlich allein, unfähig echte Beziehungen einzugehen, innerlich schier zerfetzt durch die Diskrepanz zwischen dem Potential das in ihr wütete und ihrem Unvermögen, daraus etwas zu machen. Sie möchte schreiben und das Buch beschreibt jenen Punkt, an dem sie feststellt, dass ihr Talent, die Stipendien, die Unterstützung zahlreicher wohlmeinender Mentoren, die sie bis dato trotz – oder auch gerade wegen der – Glasglocke weit über allen anderen schweben ließ, nicht mehr genügen, dass es Zeit ist selbst etwas zu tun, um sich nicht von allen anderen überholen zu lassen und zurückzubleiben mit nichts als ungenutztem Potential. Es ist auch jener Punkt, an dem sie beginnt, sich selbst als Betrügerin zu entlarven, als eine, die sich jahrelang auf ihren Möglichkeiten ausgeruht hatte. Nach einer für die Zeit üblichen aber gründlich misslungenen Elektroschockbehandlung, die sie aus ihrer Depression lösen sollte und sie schließlich einen Selbstmordversuch unternehmen lässt, landet sie mithilfe einer wohlhabenden Gönnerin in einer privaten psychiatrischen Klinik, wo sie Schritt für Schritt in ihr Leben findet.
Es ist eine kleine Weile her, als ich begann zu begreifen, dass es sich bei Zuständen, wie denen im Buch beschrieben, nicht um Einzelphänomene handelt, dass es vielmehr individuelle Ausprägungen eines immergleichen Prozesses sind. Und mit Begreifen meine ich nicht das intellektuelle Erfassen, sondern das Verinnerlichen, das Spüren der in Worte gekleideten Botschaft. Es ist ein Spüren, dass irgendwo zwischen tiefer Traurigkeit und großer Erleichterung anzusiedeln ist. Kein „aha, so ist das also bei denen“, sondern ein „oh shit, ich sitze im gleichen Boot“.
In letzter Zeit ist einiges geschrieben worden über das Los der heute 30jährigen. Nina Pauer legte mit ihrem „Wir haben keine Angst“ die „Gruppentherapie einer Generation“ vor und rechnete später in der ZEIT mit den „Schmerzensmännern“ ab. Eine hochemotionale Diskussion begann, die sich wohl auf einen gemeinsamen Nenner herunter brechen lässt: Es gibt keine verlässliche Ordnung (wenn es sie denn je gegeben hat) und die vermeintlich stärker werdenden Frauen und vermeintlich schwächer werdenden Männer werfen es sich gegenseitig vor. Ich kann es nicht mehr hören.
Tränen der Erleichterung trieb mir ein Radiobeitrag Konstantin Sakkas’ auf SWR2 Wissen in die Augen, der die Diskussion weg von den ewigen Anschuldigungen schiebt. 30 Minuten lang erklärt der 30jährige Philosoph warum „um die 30 zu sein, (…) heutzutage keine bloße generationelle Tatsache (ist), sondern eine existenzielle Herausforderung.“ Die 30-Jährigen von heute seien in einer Weise Repräsentanten der neuen Zeit, wie es vielleicht noch nie seit Ende des Ersten Weltkrieges eine Generation gewesen ist: „In ihrem Schicksal bündelt sich wie in einem Brennglas die Zukunft unserer Gesellschaft mit all ihren Chancen und Herausforderungen. Beruflich wie privat ist ihre Ausgangslage von der ihrer Eltern und Großeltern grundverschieden. Sie sind, wenngleich in vermeintlich komfortablen Verhältnissen geboren und groß geworden, viel mehr auf sich selbst, die eigene Kraft und das eigene Selbstvertrauen geworfen als die Generationen vor ihnen.“
Erwachsen ist ein Zustand, den man erreicht, wenn man Etwas entwachsen ist und dabei ist dieses Wachsen ein Prozess, der z.T. von allein passiert, der aber auch einer gehörigen Portion Eigeninitiative bedarf um halbwegs angenehm zu verlaufen. „Gesunde Disziplin“ nenne ich es gern. Im Laufe meines Erwachsenenprozesses habe ich mir ein persönliches Lebensmodell entwickelt. In diesem verschmelzen Erkenntnisse aus den Lektüren Freuds, Lacans und Alice Millers meine Beschäftigung mit C.G. Jung, einem Haufen esoterischer, bzw. schamanischer Literatur und Erfahrungen, das Lesen unzähliger Märchen, philosophisch-soziologische Analysen wie die von Adorno, Illouz, Bourdieu, Foucault, Ehrenberg und Han und letztlich meine eigene Geschichte, die sich gestaltet es ein andauernder Prozess der Verdrängung, der Verleugnung und des Verstehens. Einer Geschichte auch, die als Abziehbild des Modernisierungsprozesses unserer Gesellschaft gedeutet werden kann – so wie es auch Sakkas in seinem Radiobeitrag andeutet. Das klingt einerseits etwas größenwahnsinnig, andererseits macht es mich aber auch zu einem kleinen fast unbedeutenden Teil von etwas viel Größerem. Es macht mich zugleich zu Allem und auch zu Nichts. Und ich bin weder eine Mischung aus beidem, noch das eine oder das andere, sondern einfach beides. Eine Erkenntnis, die man nicht intellektuell fassen, sondern nur hinnehmen und hoffentlich irgendwann gut leben kann.
Der Philosoph Boris Groys, den ich während meines Hochschulstudiums in Seminaren hören durfte, schrieb einmal: „(Der Mensch) ist von der Suggestion vergiftet, dass er an sich und unabhängig von irgendwelchen Anstrengungen bereits einzigartig sei, von allen anderen Menschen auf einer bestimmten außerkulturellen, authentischen Lebensebene unterschieden. Deshalb empfindet er auch ständig eine gewisse Frustration, die aus der unvermeidlichen Erkenntnis seiner tatsächlichen unüberwindbaren kulturellen Banalität herrührt. In Wirklichkeit ist aber Banalität der Normalzustand der menschlichen Existenz, kulturelle Originalität dagegen das Produkt sehr spezieller Anstrengungen, deren Sinn und Zweck all denen nicht so ohne weiteres einleuchtet, die nicht professionell im kulturellen Bereich arbeiten.“ In Grunde beschreibt er genau damit den Zustand, unter dem Esther Greenwood und viele mit ihr leiden. Die Spannung zwischen faktischer Banalität, der simplen Tatsache, dass der Mensch einfach nur einer unter unzähligen anderen ist, genauso frisst, scheißt, vögelt, säuft und stirbt und dem Spüren, dass das doch nicht alles gewesen sein kann. Die Vergiftung rührt daher, dass wir in einem System leben, dass uns fortwährend suggeriert, dass wir alle ganz unverwechselbar sind einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir sind, jede Skepsis wird im Keim erstickt durch permanent angebotene Konsumobjekte, deren Zweck es ist, die Täuschung der Individualität aufrechtzuerhalten. Wirklich individuell ist aber, so Groys, erst der, der sich seine kulturelle Originalität erarbeitet, der, so könnte man auch sagen, in der Lage ist den Zeitgeist zu erfassen und eine eigene, vor dem individuellen Hintergrund gewachsene, Position dazu zu beziehen.
Als Esther Greenwood mit ihrer Glasglocke im Gepäck – denn los wird man sie nie, so durfte sie lernen – sich aufmacht, die Klink zu verlassen um wieder zurück ans College zu gehen, sagt ihr ihre Therapeutin unverblümt, dass eine Menge Leute ihr mit Vorsicht begegnen würden, wie eine Aussätzige mit einer Warnglocke. Die Geschichte von Esther spielt zu einer Zeit, in der man nicht über Schwierigkeiten spricht. „Wir machen da weiter, wo wie aufgehört haben, Esther“, sagte ihre Mutter zu ihr „mit süßlichem Märtyrerinnenlächeln“. „Wir tun so, als wäre das alles ein böser Traum gewesen.“ Und Esther denkt: „Für den der eingezwängt und wie ein totes Baby in der Glasglocke hockt, ist die Welt selbst der böse Traum.“
Die Zeilen erinnern mich an etwas, was ich in Slavoy Zizeks Einführung in das Denken des Psychoanalytikers Jacques Lacan gelesen hatte. Darin erläutert er Lacans hier stark vereinfachte Meinung, dass der Traum das eigentlich Reale sei und das vermeintlich Reale die Illusion, bzw. ein aus Vorstellungen zusammengestückeltes Bild. Dass das Aufschrecken des Alptraumgeplagten im Grunde nichts anderes sei als eine Flucht vor der Realität, in eine Welt die sich, so jedenfalls die Vorstellung, dank ausgeprägter Illusionierungsbegabung kontrollieren lässt. „Für Lacan“, so Zizek, „besteht die äußerste ethische Aufgabe im wahren Erwachen: nicht nur aus dem Traum, sondern aus dem Bann der Phantasie, die uns sogar stärker kontrolliert, wenn wir wach sind.“ Meine Glasglocke ist für mich zum Inbegriff der Einsamkeit geworden war. Eine Konstruktion, die ich mir irgendwann geschaffen hatte, um nicht mit den Unwegbarkeiten der Realität konfrontiert zu sein. Statt zu versuchen mir die Realität und sei es auch durch ein Gerüst von Illusionen oder dem Aufgehen in Werbebotschaften oder dem kompletten Wahnsinn – ich hätte auch ein psychopatischer Serienmörder werden können – anzueignen, hatte ich mich in einen eigenen Schutzraum zurückgezogen, der mich vor Dingen bewahrte, denen ich zu dem Zeitpunkt nicht gewachsen war. Ich hatte mich selbst abgekoppelt vom Spiel des Lebens.
Die bereits zitierten Worte Groys’ stammen aus einem Essay, in dem er sich der Frage des Neuen widmet, dass er definiert als „Vollzug eines neuen Vergleich von etwas, das bis dahin noch nicht verglichen wurde (…).“ „Das kulturelle Gedächnis“ beschreibt er daher als „die Erinnerung an diese Vergleiche“ und das Neue fände nur dann Eingang ins kulturelle Gedächtnis, wenn es seinerseits ein neuer derartiger Vergleich ist.“ Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass es das Neue nicht gibt, jedenfalls nicht in der Form, wie man sich das gemeinhin vorstellt, als etwas vollkommen anderes als das, was vorher da war, als eine Art Heilsbotschaft, ein Erlösungsversprechen aus unerträglichen Zuständen. Das Neue ist vielmehr nur eine Neuordnung des Immerwährenden. Das vorläufige Ergebnis eines kulturellen Aushandlungsprozesses. Und möglicherweise liegt genau in der Tatsache, in diesem Missverständnis des Neuen, die Erklärung dafür verborgen, warum eine Vermittlung zwischen der Selbsthilfegruppe der 30jährigen, wie Sakkas sie in seinem Radiobeitrag nennt, und der Elterngeneration so schwierig ist. Praktisch als Umkehrung der Groys’schen Theorie. Eben weil ältere Generationen annehmen (!), dass alles immer so ist wie es war und unsere Sorgen und Nöte die gleichen wie ihre sind, bieten sie uns ihre Lösungsmöglichkeiten an, die aber in unserer Realität, die sich völlig neugeordnet darstellt nur unnötiger Ballast sind. Als dem Alten entwachsene taumeln wir längst nicht erwachsen durch eine Welt der wir mit unserem angelernten Werkzeug nicht habbar werden können. Es scheint als gäbe es da eine Diskrepanz zwischen etwas, das tatsächlich schon immer so war wie es ist und einer Bewegung, die dieser Tatsache zu entkommen trachtet. Jede Generation bezieht sich auf ihr jeweils Neues, ihr jeweils uneinlösbares Heilsversprechen und verliert damit zugleich den Sinn für das Eigentliche oder das „Immerwährende“, wie ich es weiter oben nannte. Doch worin besteht dieses „Immerwährende“, das immer nur neu geordnet wird?
In meiner stetigen Fokussierung auf ein „Immerwährendes“ sorge ich mich etwas altbacken daherzukommen. Als jemand, der in vormoderne Zeiten strebt, als alles noch klar zu sein schien. Ein Gott als die eine Wahrheit hatte die Welt geschaffen und diesem war zu dienen. Punkt. Als jemand auch, der die Kontingenz, als große Errungenschaft der Aufklärung, infrage stellt und als ein Vertuschungskonstrukt zu entlarven trachtet. Meine Versuche unerträglichen Zuständen zu entkommen, verglich ich gern mit dem Bild eines Fahrers, dessen Wagen außer Kontrolle geraten ist. Ich raste ohne Bremse, das Lenkrad fest umklammert, eine kurvige Küstenstraße entlang, den drohenden Absturz dicht vor Augen. Ich brauche niemandem zu erklären, dass diese Situation nicht gerade dazu einlädt, entspannt die Füße aus dem Wagenfenster zu hängen und die schöne Aussicht zu genießen.
Das Bild des außer Kontrolle geratenen Wagens oder des Ins-Wasser-Geworfen-Werdens ohne Schwimmen zu können oder Des-am-Boden-Klebens trotz einer Gefahrensituation sind beliebte Traumsymbole, mithilfe derer unser Unterbewusstsein uns versucht etwas Essentielles mitzuteilen. Normalerweise tauchen diese Traumbilder in Lebensabschnitten auf, in denen wir beginnen die Kontrolle zu verlieren. Ich wage zu behaupten, dass es aber weniger um die Angst geht, die Dinge nicht mehr beherrschen zu können, sondern dass es vielmehr eine Ahnung davon ist, dass wir überhaupt keine Kontrolle haben können, die dort hervorblitzt. Dass vielleicht der einzige Weg irgendeine Form von Kontrolle zu haben darin besteht zu akzeptieren, dass wir keine Kontrolle haben. Und selbstverständlich ist es viel schwieriger entspannt lächelnd, weil wissend, dem Ende zuzurasen, als panisch schreiend am Lenkrad herumzudrehen. Die wirkliche Freiheit besteht also womöglich darin innerhalb unveränderlicher Gegebenheiten klar und locker zu bleiben. Es ist kaum verwunderlich, dass in den letzten Monaten Begriffe wir Burn-Out und Depression einschlägige Medien beherrschten. Die Depression kann nämlich verstanden werden als Erschöpfung, als Unvermögen weiterhin den eigenen Illusionsraum aufrechterhalten zu können.
Heute glaube ich, dass ich beim „Immerwährenden“ angekommen war. Dem, was sich immer wieder in neuem Gewand darstellt. Während sich alle in den Formeln verstricken, verlieren sie das Ergebnis aus den Augen, was im Grunde eigentlich die Aufgabe darstellt. Und damit auch die Aufgabe, als das Aufgeben von den Vorstellungen, irgendetwas kontrollieren zu können. Vielleicht hat Sakkas Recht, wenn er sagt, dass „die 30-Jährigen von heute (…) Repräsentanten der neuen Zeit (sind), (…) dass sich „in ihrem Schicksal (…) wie in einem Brennglas die Zukunft unserer Gesellschaft (bündelt) mit all ihren Chancen und Herausforderungen.“ In einem Vortrag einer Assistentin der berühmten Trendforscherin Lidewij Edelkoort hörte ich kürzlich, dass „the leitmotif for the years to come will be the dramatic and emotional way in which we will embrace the time we live in; with a new generation born in the troubled times of the turn of the century, that will be growing up without hope for their future, without a sense of well-being. (…) the only way out will be to embrace the dramatic circumstances of the ‚age of doubt’ by adopting and espousing the melancholic world view inherited from the romantics, creating an important second romantic period.“ Und wieder einmal wird sich das Alte in einem Neuen Kleid zeigen.
Ich habe keine Ahnung, wie mein weiteres Leben aussehen wird. Ob ich je Kinder haben werde, jemals in einer konventionellen Partnerschaft leben werde, jemals Geld verdienen werde, jemals eine anständige Altersvorsorge haben werde, jemals… was auch immer. Ich kann nur sagen, dass ich nie zuvor so ich, so glücklich, so in mir war wie heute auch wenn das noch oft genug sehr schmerzhaft ist und mich noch oft genug vergangene Schutzprogramme ausschalten. Dann stehe ich wieder auf und beginne von vorn. Was bei vielen als Ego-Trip verschrien ist, ist für mich der feste Glauben daran, dass manchmal ALLES zusammengetreten und aus dem Fenster geschmissen werden muss, damit es aufgeräumt und geordnet und als EIGENES zur Tür wieder hereinkommen kann. Es ist ein scheiß anstrengender Prozess mit unzähligen Rückschlägen und Zusammenbrüchen, aber ich beginne ihn zu lieben, dieses unkontrollierbare echte Leben, ebenso wie mein absolut unkontrollierbares echtes Selbst.
Zitate aus:
Slavoy Zizek – Lacan: Eine Einführung
Sylvia Plath – Die Glasglocke
Boris Groys – Über das Neue: Versuch einer Kulturökonomie. Essay
Konstantin Sakkas – Generation Gesamtkunstwerk
Foto: Julia Späth